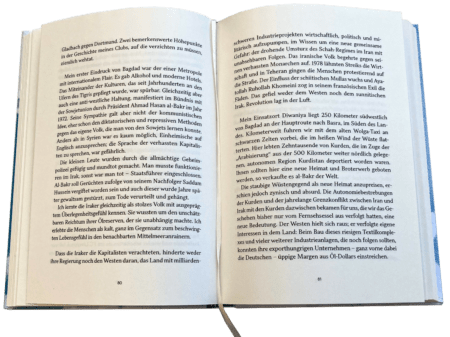
Afrika
Mein nächster Einsatz führte mich wieder einmal nach Afrika, wo ich im Laufe der vielfältigen, meist kurzen Aufenthalte in den 1970ern unzählige unvergessliche Erinnerungen angehäuft habe – zum Beispiel die von der Elfenbeinküste.
Für heutige Verhältnisse unvorstellbar war schon die Anreise: Mönchengladbach–Brüssel–Paris–Nizza–Niamey/Niger–Ouagadougou/Burkina Faso–Lomé/Togo und schließlich Abidjan, damals die Hauptstadt der Elfenbeinküste. Ich war bald 100 Stunden unterwegs, saß teilweise mit nur zehn, zwölf Passagieren in alten DC-3- und DC-6-Maschinen, die in Europa wegen technischer Mängel schon lange ausgesondert waren.
In Abidjan war ich noch nicht am Ziel. Die letzten 400 Kilometer, von der Atlantikküste nach Bouaké im Zentrum des Landes, legte ich in einem klapprigen Peugeot-Taxi zurück. Mein Fahrer beförderte mich aus der Stadt hinaus ins Dunkel der mondlosen Nacht. Auf der unbeleuchteten Piste, weit hinter Agboville, das ich aus früheren Einsätzen kannte, ruckelte das Auto erst und blieb schließlich liegen. Der Blick in den stockdunklen Motorraum half nicht weiter und so stapfte ich hinter dem Mann hinein in den nachtschwarzen Busch mit seinen undefinierbaren Geräuschen fiepender Tiere und knackender Zweige. Gottergeben und auf das Schlimmste gefasst, folgte ich ihm in kurzem Abstand. Ich sah mich schon ausgeraubt und ermordet im Dschungel liegen, mein Leib von wilden Tieren zerfetzt. Niemand zu Hause hätte je von meinem Sterbeort und den Umständen meines Todes erfahren.
Ein helles Flackern in der Ferne holte mich aus meiner Todesfantasie. Da war ein Kral und in seiner Mitte ein Feuer, in dem die trockenen Zweige knackten. Die Bewohner schliefen in ihren Hütten, nur der Hüter des Feuers, das die Wildtiere fernhielt, war hellwach und stand auf, als er uns erblickte. Die Dunkelheit gab den Mann nicht zu erkennen, wie er da auf uns zukam. Ich sah nur das Weiß seiner Augen und Zähne. Er lud uns ans Feuer ein, reichte Wasser und Brot und half uns nach einem Schwätzchen dabei, das Auto wieder flottzumachen.
(...)
Das sehr eigene Zeitverständnis der Afrikaner nervte mich immer dann, wenn es meinen persönlichen durchstrukturierten Zeitplan durchkreuzte. Manchmal brachte sie mich auch ans Nachdenken. Zum Beispiel bei einem Greis, der seine Tage vor seiner Hütte sitzend verbrachte. Sein Blick folgte mir, wenn ich morgens an ihm vorbeieilte, er beobachtete mich, wenn ich verschwitzt in die Pause und wieder zum Job ging, und lächelte mich milde an, wenn ich abends müde gearbeitet an ihm vorüber in den Feierabend schlich. Der Alte war wie ein Stillleben – tagein, tagaus bot er mir dasselbe Bild mit seinen vier Bananen, die er über den Tag verspeiste, und seiner gelassenen Aufmerksamkeit für mich. Damals bedauerte ich den Mann für sein eintöniges, armseliges Dasein. Mit den Jahren kam ich zu der Erkenntnis, dass auch er mich vermutlich bedauert hat. Wie kann man so versessen arbeiten und durchs Leben hasten, mag er sich gefragt haben. Ich glaube, sein ruhiger Lebensfluss bescherte dem alten Mann eine tiefe Zufriedenheit. So nehme ich ihn mir bis heute zum Vorbild, wenn es hektische Zeiten zu bewältigen gibt.
Aus:
Am Abgrund – Mein Leben zwischen Himmel und Hölle
Harry Hosell, 2020
